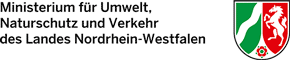Nein zum geplanten Landeswassergesetz – Gewässerrandstreifen sind notwendig
- Details
Biologe Dr. Thomas Chrobock ist entsetzt. Im neuen Landeswassergesetz ist geplant, Gewässerrandstreifen bis auf Hanglagen zu streichen. Damit würden wichtige Pufferzonen wegfallen. Werden neben Bächen und Flüssen Pflanzenschutzmittel benutzt, können diese nun ungehindert ihren Weg in die Gewässer finden. „Es sind leider nur zehn Prozent unserer Gewässer in einem guten ökologischen Zustand in Deutschland“, berichtet Chrobock. „Und besser wird es mit der geplanten Gesetzesänderung bestimmt nicht.“ Die Gewässerrandstreifen spielen zudem für viele Pflanzen und Tiere eine wichtige Rolle als Lebens- und Rückzugsräume. Durch den Wegfall der Flächen wird ihr Lebensraum massiv eingeschränkt beziehungsweise vernichtet.
Vegetationskartierung – was Pflanzen uns erzählen können
- Details
Artenschutz rückt nicht nur aufgrund der kürzlich gestarteten „Volksinitiative Artenvielfalt NRW“ ins Blickfeld informierter Menschen. Sie ist grundsätzlich ein Schlüsselthema beim Engagement für die Umwelt. Die Erfassung von seltenen und gefährdeten Pflanzen in den Naturschutzgebieten der NABU-Naturschutzstation Niederrhein spielt dabei eine grundlegende Rolle und gehört zu den Aufgaben der Landschaftsökologinnen Katja Plumbaum und Lisa Marga.

Landschaftsökologin Lisa Marga auf der Suche nach Wasser- und Sumpfpflanzen im Naturschutzgebiet Moiedtjes. (Foto: Isabel Schlurmann)
Mit Karte, Lupe und Bestimmungsbuch ausgestattet sind die beiden von Frühlingsanfang bis in den Hochsommer in den Naturschutzgebieten unterwegs, in denen sie für die Station die Vegetationskartierung durchführen. Das bedeutet, sie erfassen in welcher Kombination und Dichte die Pflanzen in den Gebieten vorkommen. Eine Zusammenstellung typischer Arten ergibt eine Pflanzengesellschaft. Beispiele sind etwa eine Sumpfdotterblumen-Wiese oder ein Orchideen-Buchenwald. Die Pflanzengesellschaften werden dann in eine Vegetationskarte eingetragen.
Die Summe der Arten, das heißt die Pflanzengesellschaften, geben Auskunft über Boden, Klima, Wasser und Bewirtschaftung. Selbst ohne das Gelände zu kennen, wissen Botaniker so anhand der Vegetationskarte sehr genau über die dortige Natur und den Zustand des Gebiets Bescheid.
Kartierungen sind Grundlage für alle Naturschutzmaßnahmen
„Wenn du nicht weißt, was vor Ort wächst, hast du keine Möglichkeit richtig zu handeln“, erläutert Katja Plumbaum den Zweck der Kartierungen. Und Lisa Marga ergänzt: „Die Verarmung und der Rückgang des Grünlands und von Feuchtgebieten in Nordrhein-Westfalen sind nur weitere Teile des großen Umwelt-Puzzles. Deshalb ist Artenschutz neben klimafreundlichem Handeln und Energiewende ein Schlüsselthema für eine lebenswerte Zukunft.“
Aktuell sehen Plumbaum und Marga unter anderem Auswirkungen der Trockenheit und eines Überschusses von Stickstoff in der Landschaft. So beobachten die beiden, dass Pflanzen, die Feuchtigkeit anzeigen wie die Kuckuckslichtnelke oder der Beinwell, zurückgehen. Auch Pflanzen, die so genannte magere Standorte benötigen, werden weniger. Dafür nimmt die nährstoffliebende Brennnessel zu. Was wir Menschen vermutlich erst in einigen Jahren als Folge von Klimakrise und Umweltverschmutzung zu spüren bekommen, zeichnet sich also schon jetzt in der Vegetation ab.
Anhand des Wissens aus den Kartierungen können konkrete Maßnahmen für den Naturschutz geplant und ergriffen werden. Das können etwa umfangreiche Veränderungen beim Wassermanagement wie etwa das Rückstauen von Gräben sein, aber auch kleinere Aktionen, zum Beispiel das Rückschneiden von Gehölzen oder das Anpassen des Mahd-Zeitpunkts. Da solche Maßnahmen nicht nur die Vegetation, sondern unter anderem auch den Wiesenvogelschutz und die landwirtschaftliche Nutzung betreffen, ist eine enge Abstimmung und gute Zusammenarbeit aller Beteiligten erforderlich. Doch nicht alle dokumentierten Probleme lassen sich vor Ort lösen. Viele mitunter dramatische Entwicklungen, wie die Austrocknung der Landschaft, lassen sich nur durch politische Vorgaben abschwächen oder umkehren. Deshalb hat der NABU zusammen mit anderen Naturschutzorganisationen die Volksinitiative Artenvielfalt NRW ins Leben gerufen. Diese ermöglicht es allen Bürgerinnen und Bürgern per Unterschrift für die Lösung dieser Probleme zu stimmen.
Arbeiten in diesem Jahr
In diesem Jahr beschäftigt sich Katja Plumbaum mit der Hartholz-Aue in der Emmericher Ward und dem Grünland in den Rindernschen Kolken. Auwälder sind durch periodisch einströmendes Wasser gekennzeichnet und für die Emmericher Ward gebietsprägend. Hier untersucht Plumbaum die Pflanzengesellschaften in Kraut-, Strauch- und Baumschicht. In den Rindernschen Kolken wird das Grünland unter die Lupe genommen. Das bedeutet, Wiesen und Weiden werden auf ihre Pflanzengesellschaften untersucht. Ähnlich sieht die Arbeit von Lisa Marga aus, die für die Gewässerpflanzenkartierung verantwortlich ist. Mit Wathose und Kescher bewaffnet untersucht sie dieses Jahr die Wasser- und Sumpfpflanzen im Naturschutzgebiet Moiedtjes.
Bei ihrer Arbeit erstellen die Landschaftsökologinnen neben der Vegetationskarte auch eine Artenliste, in der aufgeführt ist, wie viel Anteile jede Art vor Ort ausmacht. Pflanzen von der Roten Liste gefährdeter Arten oder mit besonderen Merkmalen, beispielsweise ein sehr hohes Alter bei Bäumen, werden gesondert dokumentiert. „Mir begegnen immer mal wieder Arten, die ich nicht kenne“, antwortet Plumbaum auf die Frage, ob sie alle Pflanzen aus dem Stehgreif bestimmen kann. „Das macht aber auch den Reiz bei der Arbeit aus: Man lernt immer dazu.“
Die beiden Landschaftsökologinnen erzählen mit Nachdruck, aber auch mit riesiger Begeisterung von ihrer Arbeit. „Den ganzen Tag draußen sein, nichts als Natur hören und sehen – das ist einfach toll“, sagt Lisa Marga. Und ergänzt dann: „Besonders schön ist es, wenn ich meine Begeisterung mit anderen teilen und diese damit für den Naturschutz gewinnen kann.“
Vorgängerprojekt abgeschlossen - Staffelstab übernommen
- Details
Die NABU-Naturschutzstation Niederrhein hat das LIFE-Projekt „Fluss und Aue Emmericher Ward“ erfolgreich abgeschlossen. Dank einer neu geschaffenen, parallel zum Rhein verlaufenden durchströmten Nebenrinne sowie der Entwicklung eines größeren Auenwaldkomplexes entstand in der Emmericher Ward neuer Raum für Flussnatur von europäischer Bedeutung. Durch die eingeworbenen Projektmittel profitierte zudem die lokale Wirtschaft; das Projekt half somit, Arbeitsplätze in der Region zu sichern. Das Gebiet ließ sich am Sonntag auch Landratskandidat Peter Driessen zeigen.
Projektleiter Klaus Markgraf-Maué blickt zum Projektende zurück: „Nach langen Vorbereitungen und dem Start des Vorhabens im Jahr 2012 dürfen wir heute abschließend feststellen: Die Mühen haben sich gelohnt.“ Ziel war es, den Lebensraum bedrohter Arten des Rheins und seiner Aue wiederherzustellen und zu erweitern, darunter Vogelarten wie Blaukehlchen, Eisvogel und Uferschwalbe, aber auch verschiedene Fischarten. Um die Fischpopulation nachhaltig zu sichern und zu vergrößern, sollten Lebensräume zum Laichen und Aufwachsen sowie zur Rast und Nahrungssuche geschaffen werden.
„Mittlerweile können wir sehen, dass große Jungfischschwärme in der Nebenrinne heranwachsen – geschützt vor dem Wellenschlag der Schiffe. Darunter finden sich auch die Zielarten des Projekts, wie Nase und Barbe. Sie gehören zu den anspruchsvolleren, strömungsliebenden Arten. Das heißt, es ist uns offenbar gelungen, mit der Nebenrinne einen neuen Lebensraum von hoher Qualität zu schaffen“, stellt Markgraf-Maué fest.
Bereits im vergangenen Jahr habe man in der Emmericher Ward zudem beispielsweise drei Brutreviere des Blaukehlchens zählen dürfen, berichtet der Projektleiter. „Sie befanden sich ausschließlich in dem Maßnahmenbereich im Umfeld der neuen Nebenrinne. So eine Anzahl gab es zuletzt 2002.“ Auch in diesem Jahr gebe es im Zuge der laufenden Brutsaison erste Beobachtungen, die auf neue Reviere in Weidengebüsch und Staudenfluren direkt an der Nebenrinne schließen lassen.
Darüber hinaus konnte dokumentiert werden, dass weitere Fische, Insekten und andere Rheinbewohner von dem neuen Lebensraum im Bereich von Nebenrinne und Aue profitieren.
Davon zeigte sich auch Landratskandidat Peter Driessen beeindruckt, der am vergangenen Sonntag an einer Exkursion ins Projektgebiet teilnahm: „Ich empfinde den heutigen Morgen als Bereicherung. Zum einen habe ich viel Wissenswertes über die Funktion eines Auenwaldes, den Wasserhaushalt in der Aue und die Rhein-Nebenrinne erfahren. Zum anderen durfte ich Menschen kennenlernen, die sich mit großer Freude, trotz teilweise erheblicher Widerstände, jahrzehntelang für Natur und Umwelt einbringen.“
Für die Umsetzung des LIFE+-Projektes in der Emmericher Ward standen rund 3,1 Millionen Euro zur Verfügung. Diese Summe verteilte sich auf die gesamte Projektlaufzeit von 2012 bis 2020 und wurde zu einem großen Teil für Baumaßnahmen und Planungsleistungen eingesetzt. Der überwiegende Teil der Projektmittel wurde in der Region verausgabt, beispielsweise durch Aufträge an Unternehmen aus dem Kreis Kleve und der Gemeinde Emmerich.
Die Finanzierung erfolgte durch das Förderprogramm LIFE+ Natur der EU, das Land NRW, die Kurt Lange Stiftung, die HIT Umwelt- und Naturschutzstiftung, den NABU-Bundesverband und den Projektträger NABU-Naturschutzstation Niederrhein.
Mit dem abgeschlossenen Projekt ist die Arbeit der NABU-Naturschutzstation vor Ort nicht vorbei. „Wiederherstellung des Feuchtgebietscharakters der Rheinaue Emmericher Ward“ heißt ein neues LIFE-Projekt, mit dem sich die Naturschützer weiterhin für die Verbesserung des Zustandes der Rheinaue engagieren. Projektleiter ist Dr. Thomas Chrobock, der das Projekt auch auf der Exkursion vorstellte. Er machte deutlich, dass gerade vor dem Hintergrund der prognostizierten Folgen des Klimawandels der Erhalt dieses international bedeutsamen Feuchtgebiets für die Sicherung der Biodiversität sehr wichtig ist. Die Maßnahmen des Projektes werden derzeit im Detail geplant und ab Herbst 2021 umgesetzt.
Zur Projektwebsite de Vorgängerprojekts
Ausflug in die Emmericher Ward - unter anderem mit Landratskandidat Peter Driessen und mit Klaus Markgraf-Maué
(Foto: Dr. Thomas Chrobock)
Naturschutzprojekte in der Emmericher Ward: Exkursion mit Peter Driessen
- Details
Die NABU-Naturschutzstation Niederrhein veranstaltet eine öffentliche Exkursion mit dem Landratskandidaten Peter Driessen. Am Sonntag, 28. Juni geht es von 10 bis 12:30 Uhr in die Emmericher Ward. Dort führt Klaus Markgraf-Maué die Gruppe zu den von der EU geförderten LIFE-Projekten der Naturschutzstation und erläutert Wissenswertes zur Rhein-Nebenrinne, zum Auenwald und dem Wasserhaushalt der Aue. Experte Markgraf-Maué ist seit 24 Jahren in der Naturschutzstation beschäftigt und wird ab Juli stellvertretender Vorsitzender der Station.
Teilnehmende haben die Möglichkeit, mehr über die Haltung von Peter Driessen zum Naturschutz zu erfahren. Die NABU-Naturschutzstation plant ähnliche Aktionen mit den weiteren Landratskandidaten. Sie bahnt daher Gespräche mit Silke Gorißen und Guido Winkmann an und möchte allen die Anforderungen an die Naturschutzarbeit nahebringen.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist kostenlos. Der Treffpunkt am 28. Juni wird bei der erforderlichen Anmeldung genannt. Aufgrund der Corona-Pandemie wird die Teilnehmerzahl auf zwanzig Personen begrenzt und die erforderlichen Auflagen – etwa bezüglich Hygiene, Abstand, Mundschutz, Datenerfassung – sind zu erfüllen. Zudem empfiehlt es sich, festes Schuhwerk und an das Wetter angepasste Kleidung zu wählen.
Weitere Informationen und Anmeldung: NABU-Naturschutzstation Niederrhein, Telefon: 02821-713988-0 oder www.nabu-naturschutzstation.de/de/veranstaltungen
Molche, Kröten, Frösche – Amphibienerfassung rund um Kleve
- Details
Die Naturschutzgebiete rund um die NABU-Naturschutzstation Niederrhein beheimaten verschiedenste Amphibienarten. Dieses Jahr sind Biologin Ortrun Heine und Praktikantin Corinna Bartel wieder unterwegs, um das Vorkommen der Molche und Frösche zu untersuchen. Bei der Entdeckung eines europaweit streng geschützten Kammmolches ist die Freude besonders groß.
In regelmäßigen Abständen findet die Amphibienkartierung der NABU-Naturschutzstation Niederrhein statt. Das bedeutet, die Biologinnen der Station rücken schwer bepackt mit Rucksäcken aus – gefüllt unter anderem mit Molchreusen, Kescher und Wathosen. Ziel ist es, das Vorkommen der Amphibien in den umliegenden Naturschutzgebieten zu dokumentieren, um es mit alten Daten zu vergleichen. Die Informationen werden gebraucht, um Aussagen zur Entwicklung der Gebiete zu machen und Maßnahmen abzuleiten. Zu den Gebieten der Station, die für die Amphibienkartierung relevant sind, gehören das Kranenburger Bruch, die Rindernschen Kolke, die Emmericher Ward und die Moiedtjes-Teiche.
Den Gebieten gilt in diesem Jahr besondere Aufmerksamkeit, da die Biologinnen hofften, Kammmolchfunde der letzten Kartierungen zu bestätigen. Der Kammmolch ist nicht nur wegen seiner Größe oder seiner Seltenheit besonders. Er ist zudem europaweit nach Flora-Fauna-Habitat-Richtlinien geschützt. Das bedeutet, dass er nicht verletzt oder getötet werden darf und sein Lebensraum geschützt werden muss. Seine Gefährdung in Europa, aber auch hier am Niederrhein geht vor allem von der Zerstörung der Kleingewässer aus, in denen er zu Hause ist. Diese werden unter anderem zunehmend durch Pestizide verschmutzt oder für Landschaftsnutzung zugeschoben. Diese Kleingewässer trocknen außerdem wegen des Klimawandels mit seinen höheren Temperaturen und geringeren Niederschlägen stärker aus. Auch Verluste durch den Straßenverkehr spielen eine Rolle. „Als wir Anfang April dann tatsächlich den ersten Kammmolch in der Emmericher Ward nachgewiesen haben, war das ein besonders schöner Moment“, sagt Ortrun Heine.
Neben den Kammmolchen kann man in den Naturschutzgebiete rund um Kleve auch auf Teichmolche, Erdkröten und Gras- oder Wasserfrösche treffen. Außerdem begegnet man natürlich nicht nur adulten, also erwachsenen Amphibien, sondern auch Laich und Kaulquappen beziehungsweise Molchlarven. Um all das zu unterscheiden, brauchen auch erfahrene Biologinnen einen Bestimmungsschlüssel.
Bei der Untersuchung, für die die NABU-Naturschutzstation Niederrhein stets eine Ausnahmegenehmigung beim Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz beantragen muss, steht das Wohlergehen der Tiere natürlich im Vordergrund. Deshalb werden Arbeitsgeräte, Kleidung und Hände vor und nach der Arbeit in den Gebieten gründlich desinfiziert. Dabei geht es vor allem darum, die Amphibien vor dem Chytridpilz zu schützen. Der verursacht die sogenannte „Salamanderpest“. Dieser Pilz wurde vermutlich aus Asien eingeschleppt und befällt die Haut der Amphibien, was zu ihrem Tod führt. „Das Desinfizieren ist zwar ein riesiger Arbeitsaufwand, aber natürlich extrem wichtig für den Schutz der Tiere“, sagt Ortrun Heine. Nach den Untersuchungen vor Ort werden die gefangenen Molche und Frösche selbstverständlich wieder freigelassen.
Wenn Ortrun Heine von ihrer Arbeit spricht, bleibt einem nichts anderes übrig, als sich von der Begeisterung für die Natur anstecken zu lassen. Wie allen Biologinnen und Biologen gefalle ihr am Kartieren besonders, so viel Zeit draußen verbringen zu dürfen. „Plötzlich springt ein Hase auf, Rehe brechen durch das Gestrüpp, ein Großer Brachvogel ist zu hören oder ein Eisvogel zu beobachten. Das ist alles so schön. Also, wem da nicht das Herz aufgeht…“
Praktikantin Corinna Bartel bei der Amphibienkartierung (Foto: Ortrun Heine)
Pressemitteilung des NABU NRW: Rheinausbaupläne sind nicht zeitgemäß
- Details
Warum sind wir gegen die unzeitgemäßen Rheinausbaupläne, die derzeit von der Landesregierung diskutiert werden? Das erklärt unser Flussspezialist Klaus Markgraf-Maué in einer Pressemitteilung des NABU NRW. Zu Pressemitteilung auf der Website der NABU-Naturschutzstation Niederrhein.